Call of Cthulhu: Prisoner of Ice REVIEW
Während der französischen Publisher und Entwickler Infogrames kleine Kinder gerne mit beinharten Lizenz-Platformern piesackte, durften sich ältere Semester von deren von H.P. Lovecraft inspirierten Horror-Abenteuern drangsalieren lassen. Während das 1992 veröffentlichte „Alone in the Dark“ Kultstatus erlangen konnte, fristen die Call of Cthulhu-Abenteuer von Infogrames eher ein Dasein als Obskuritäten. 1993 erschien mit „Call of Cthulhu: Shadow of the Comet“ der erste Teil einer kurzlebigen Reihe von Point & Click-Adventures, welche bereits mit der 1995 veröffentlichten Fortsetzung Call of Cthulhu: Prisoner of Ice zu Grabe getragen wurde. Warum man sich die Mühe machte zu Prisoner of Ice 2 Jahre später Japan-Exklusive PSX- und Sega Saturn-Versionen rauszuhauen, ist mir übrigens ein absolutes Rätsel.
Heutzutage kann man Infogrames Call of Cthulhu-Adventures jedenfalls mühelos über Steam und GoG beziehen. Hier unterziehe ich dem zweiten Teil Call of Cthulhu: Prisoner of Ice einem Test.
Eldritch-Monster aus der Tiefkühltruhe

Januar 1937, das britische U-Boot H.M.S. Victoria ist auf geheimer Mission am Südpol unterwegs. Der norwegische Entdecker Björn Hamsun wurde zusammen mit drei versiegelten Holzkisten aus einer geheimen Nazibasis befreit. Als Oberleutnant O’Leary gerade dabei ist die dritte Kiste an Bord zu bringen, greift ein Kampfflugzeug der Nazis an. Zwar kann der Flieger abgeschossen werden, jedoch bricht die Kiste plötzlich auf und deren monströser Eldritch-Inhalt kostet O’Leary das Leben. Dem Rest der U-Boot-Besatzung gelingt jedoch vorerst die Flucht.
Doch allzu lange können die Briten nicht verschnaufen, denn ein deutscher Zerstörer taucht auf und sorgt für eine Bombenstimmung. Ein Feuer bricht an Bord der Victoria aus, welches das Siegel einer weiteren Kiste bricht und somit ein weiteres Eldritch-Monster entfesselt. Kapitän Lloyd fällt der Kreatur zum Opfer, womit nun Oberleutnant Ryan der ranghöchste Offizier ist und das Kommando des U-Boots übernehmen muss. Nun liegt es an Ryan, einen Weg zu finden das Vieh loszuwerden, ehe weitere Crewmitglieder dran glauben müssen.
Doch das ist natürlich nur der Einstieg ins Spiel. Nach der U-Boot-Episode finden wir heraus, dass unser Protagonist Ryan ein Undercover-Agent ist, der einen Verräter enttarnen soll. Seine Suche nach Antworten verwickelt ihn immer tiefer in die gruseligen Geschehnisse und lässt ihn sogar das Geheimnis seiner mysteriösen Herkunft entdecken. Es wird sogar ein Bogen zu den Ereignissen des Vorgängers „Call of Cthulhu: Shadow of the Comet“ gespannt. Es ist jedoch nicht nötig dieses Adventure gespielt zu haben, um die Handlung von Call of Cthulhu: Prisoner of Ice nachvollziehen zu können.
Auch wenn sich das alles jetzt sehr spannend anhört, so leidet die Handlung von Prisoner of Ice unter vielen Problemen. So ist der kosmische Horror á la Lovecraft kaum zu verspüren. Die Eldritch-Monster, welche hier nur als „Prisoner“ bezeichnet werden scheinen den Venus-Echsenmenschen aus der Lovecraft-Kurzgeschichte „In den Mauern von Eryx“ nachempfunden zu sein. Dummerweise sind die Venus-Echsenmenschen ja eigentlich ein zivilisiertes Völkchen, die niemanden was tun, solange man sich nicht an deren Reliquien vergreift. Das Quellenmaterial wird von Infogrames also nicht unbedingt respektvoll behandelt. Als reine Monster wirken die Prisoner jedenfalls wenig gruselig und werden schon zu Beginn des Spiels regelmäßig verwendet.
Obendrein scheint sich das Spiel eh nicht zu ernst zu nehmen. Untersuchte Hotspots bringen viele humoristische Kommentare Ryans zum Vorschein. Die Geschehnisse des Spiels gehen jedenfalls völlig spurlos an dem jungen Mann vorbei, das schließt auch den großen Storytwist bezüglich Ryans Herkunft ein, den unser Held sogar völlig unkommentiert lässt.
Im generellen wirkt die Handlung völlig überhastet. Viele Details werden nur unzureichend erklärt und kaum einer der Charaktere bekommt genügend Bildschirmzeit, um vernünftig vom Spieler zugeordnet werden zu können. Dies alles sorgt dafür, dass die Handlung von Prisoner of Ice erschreckend tollpatschig herüberkommt und weder Horror- noch Abenteuerstimmung aufkommen möchte. Jedenfalls hat das Ding wenig mit dem Cthulhu-Mythos zu tun. Es fühlt sich eher wie ein schlechter Klon eines Indiana Jones-Abenteuers an, welches mit beliebigen Sci-fi-Elementen angereichert wurde. Gegen Ende des Spiels ballert Ryan sogar mit ner Laserwumme herum.
Ein Standard-Adventure, welches krampfhaft versucht Druck aufzubauen

Das Spiel ist zum größten Teil ein generisches Point & Click-Adventure. Man dirigiert Ryan via Mauscursor durch die Screens, nutzt die Maustasten um mit Hotspots zu interagieren (linke Maustaste) oder diese zu betrachten (rechte Maustaste), redet mit NPCs und sammelt Gegenstände ein, welche in einer Inventarleiste gehortet werden, die am oberen Bildschirmrand aufpoppt. Gesammelte Gegenstände können gegebenenfalls untereinander kombiniert werden und müssen verwendet werden, um diverse Problemstellungen zu lösen.
In seltenen Fällen bietet Call of Cthulhu: Prisoner of Ice auch mal ein Apparaturrätsel. Hier gilt es dann Kabelleitungen in einem Verteilerkasten umzuleiten oder einen Tresorcode einzugeben. Steuerung und Spielbarkeit sind erfreulich bequem gehalten und stellen eine drastische Verbesserung zum Vorgänger dar, der mit einer sperrigen und veralteten Steuerung nervte.
Auch der Schwierigkeitsgrad von Prisoner of Ice wurde, trotz einiger Mondlogik-Anfälle, im Vergleich zu „Call of Cthulhu: Shadow of the Comet“ stark entschärft. Problematisch ist jedoch das Pixelhunting. Die Gegenstände und Hotspots muss man oftmals mit der Lupe suchen, und aufgrund des hohen Alters des Spiels, gibt es auch keine Hotspotanzeige.
Das größere Problem sind jedoch die zeitkritischen Passagen, welche mit einer Game Over-Cutscene drohen. Die Zeitlimits dieser Passagen sind sehr kurz gehalten. Selbst wenn behauptet wird, dass man 10 Minuten Zeit hätte, folgt schon nach eins, zwei Minuten das Game Over. Aber meistens hat man sogar nur wenige Sekunden Zeit die korrekte Aktion auszuführen. Führt man eine falsche Aktion aus, heißt es freilich ebenfalls Game Over. Und diese zeitkritischen Krisensituationen sind keineswegs ein seltenes Gimmick, sondern ein zentraler Bestandteil des Spielerlebnisses. Sie treten recht häufig auf und begleiten einem von Anfang bis Ende durch das gesamte Spiel.
Wer sich bei seinen Point & Click-Adventures also gerne entspannt und in aller Ruhe knobelt, der hat sich mit Prisoner of Ice das falsche Abenteuer zugelegt. Ich selbst musste auch an einer Stelle eine Komplettlösung zu Rate ziehen, da ich nach der gefühlt 20ten Hinrichtung Ryans in kurzer Abfolge echt keinen Bock mehr hatte. Natürlich muss man sich die Todessequenzen nicht jedes mal reinziehen, sondern kann jederzeit das Hauptmenü aufrufen, um einen Spielstand zu laden. Nach Abschluss des Spiels wurde mir auch klar, warum Prisoner of Ice mit Pixelhunting und andauernden Todesfallen nervt. Das Game ist nämlich verdammt kurz. Obwohl ich es zum größten Teil aus eigener Kraft geknackt habe, war ich nach unter sechs Stunden durch. Ohne eben genannte Maßnahmen zur Spielzeitstreckung wäre das Ding wohl schon nach 2-3 Stunden durchgekaut gewesen.
Ein schlechter Witz ist auch die Auswahl aus zwei verschiedenen Enden, welche sich nur gering voneinander unterscheiden und ohnehin völlig frei zum Schluss des Spiels angewählt werden dürfen – was soll das?
Grafik und Sound

Grafisch ist das Spiel für seine Zeit ganz gut gelungen. Die Hintergrundgrafiken sind handgezeichnet und angenehm detailverliebt. Obendrein wird eine gute Palette an abwechslungsreichen Ortschaften geboten. Garniert wird das ganze durch ansprechende Zwischensequenzen. Einige wenige Szenen wie U-Boot-Fahrten werden in stimmigen Rendersequenzen dargestellt, meistens finden jedoch geringfügig animierte Artwork-Zeichnungen Verwendung, welche die Charaktere hervorheben. Letztere sind aber auch hübsch anzuschauen und verbreiten sogar etwas Filmflair.
Die Achillesverse im grafischen Bereich sind jedoch die merkwürdigen Charaktersprites. Diese sehen so aus, als hätte man Plastikpüppchen á la G.I. Joe digitalisiert. Und deren krude Animationen bestärken diesen Eindruck. Die Charaktersprites sind jedenfalls waschechte Immersions-Töter und fügen den grafischen Gesamteindruck massiven Schaden zu.
Mit dem Soundtrack von Call of Cthulhu: Prisoner of Ice bin ich nicht warmgeworden. Der OST versucht natürlich den Terror der Eldritch-Monster zu vermitteln, ist jedoch derart laut und aufdringlich, dass er mal überhaupt nicht zum gemächlichen Gameplay eines Point & Click-Adventures passt und daher oftmals eher nervt, statt Furcht einzuflößen. Positiv ist hingegen die deutsche Sprachausgabe, welche für ein Spiel von 1995 bemerkenswert professionell und kompetent umgesetzt wurde. Selbiges gilt natürlich auch für die deutsche Textübersetzung.
Das könnte dir auch gefallen











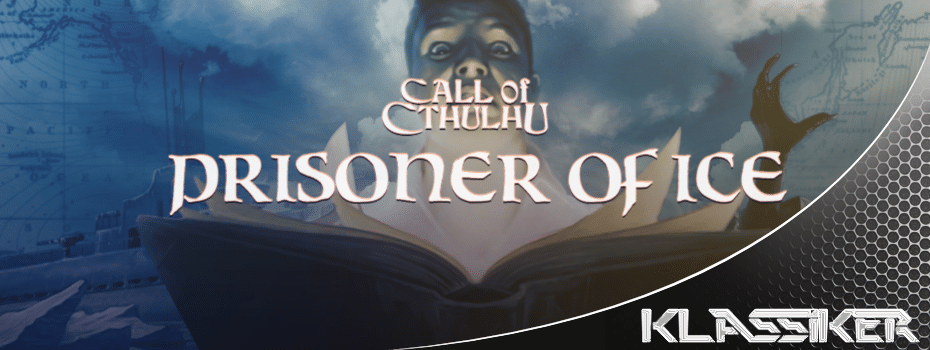















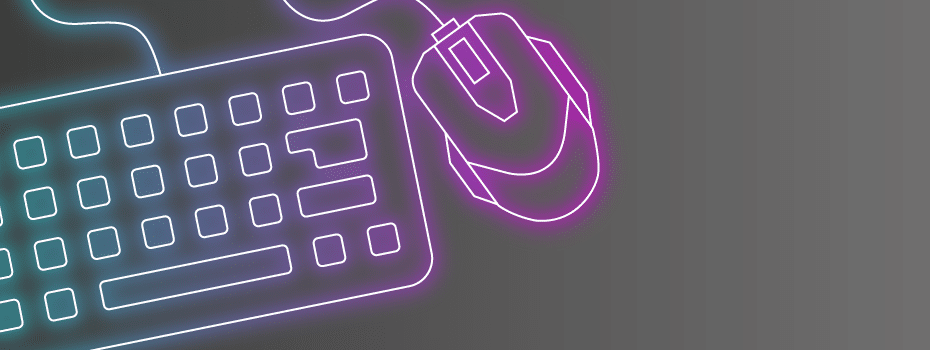


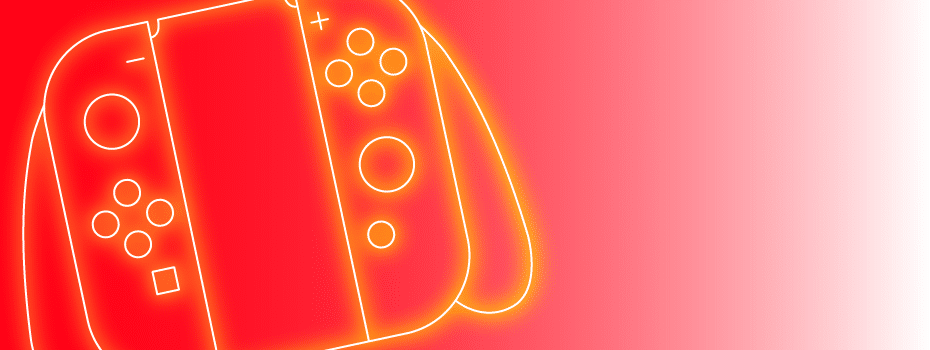











Schreibe einen Kommentar