Layers of Fear REVIEW
Anfang 2012 wurde ein „Spiel“ namens „Dear Esther“ veröffentlicht und begründete ein neues Subgenre der Adventure-Spiele. Wohlmeinende Zungen bezeichnen solche Titel als „Exploration Games,“ kritischere Stimmen hingegen sprechen von „Walking Simulators,“ weil das „Gameplay“ solcher Spiele hauptsächlich aus der Erkundung der Umgebung, dem Zuhören des Erzählers und dem lesen einiger Dokumente besteht. Unterm Strich wurde dieses Subgenre aber sehr positiv aufgenommen. Nicht nur „Dear Esther“ sondern auch Titel wie „Gone Home,“ „Everybody’s Gone to the Rapture“ oder „The Vanishing of Ethan Carter“ konnten bislang viele Fans für sich gewinnen. Mitte Februar diesen Jahres veröffentlichte das polnische Entwicklerstudio „Bloober“ (A-Men, Brawl) einen weiteren Ableger des Exploration Genres, schieben mit ihrem Layers of Fear jedoch den Fokus verstärkt auf Grusel und die inzwischen kritisch beäugten „Jump Scares.“
Ob die Schichten der Angst dem Spieler wirklich das fürchten lehren oder nur ein müdes Lächeln herauskitzeln können und was das Spiel sonst noch zu bieten hat, schauen wir uns im folgenden Test an.
Künstlerische Schaffenskrise

Man übernimmt die Rolle eines nicht näher vorgestellten Künstlers, der nicht nur mit einer künstlerischen Schaffenskrise zu kämpfen hat, sondern vor allem auch mit dem eigenen Wahnsinn. Zu Beginn weiß man nichts über den Hauptcharakter, was ihm widerfahren ist oder was ihn genau in den Wahnsinn getrieben hat. Ziel ist es das ultimative Meisterwerk auf die Leinwand zu zaubern, aber das ist einfacher gesagt als getan, denn der Künstler akzeptiert für sein „Magnum Opus“ nur die hochwertigsten Materialien und Arbeitsutensilien, die sich freilich aus Dingen wie Farben, Grundierung und Pinsel zusammensetzen. Leider liegen die hierfür vorgesehenen Materialien kreuz und quer im luxuriös eingerichteten viktorianischen Familienhaus verborgen und müssen nun vom Künstler bzw. dem Spieler aufgespürt werden. Damit erhofft sich der Protagonist nicht nur sein Meisterwerk zu vollenden und sich somit aus der plagenden Schaffenskrise zu befreien sondern auch einen Schlussstrich unter die traurigen Verluste seiner Vergangenheit zu setzen, welche auch die Quelle seiner psychologischen Probleme sind.
Dummerweise kommen uns dabei die Wahnvorstellungen des Künstlers in die Quere. Seine Ängste, Schuldgefühle und (Selbst)hass projizieren sich schon recht bald in Form eines Labyrinths, welches den Räumen und Fluren des Eigenheims zu einem bedrohlichen Eigenleben verhilft. Richtig schlimm wird’s aber erst, als der entstellte Poltergeist der verhassten(?) Ehefrau aufkreuzt um ihren Göttergatten die imaginäre Hölle heiß zu machen. Gibt es wirklich einen Ausweg aus dem Wahnsinn?
Wie viel man aus der Story herausziehen wird, hängt in erster Linie von der Entdecker- und Leselust des Spielers ab. Viele Dinge erschließen sich dem Spieler nur dann, wenn das entsprechende Dokument aufgespürt und durchgelesen wird. So wundert man sich direkt zu Beginn des Spiels, warum die Kamera (man steuert den Künstler aus der Egoperspektive) beim laufen so unangenehm wackelt. Aber bereits im Prolog kann man ein entsprechendes Schriftstück vorfinden, welches offenlegt, dass der Künstler ein Krüppel ist und mit einer Beinprothese herumläuft. Und siehe da: Plötzlich ergibt die wackelnde Laufanimation einen Sinn! Und genau auf diese Weise muss man die Handlung von Layers of Fear aus eigener Kraft aufdröseln. Findige Spieler lernen schnell, dass der Künstler ursprünglich glücklich verheiratet war und sogar eine Tochter hat. Man lernt aber auch, dass er offenbar ein ernsthaftes Alkoholproblem hat und irgend etwas schlimmes mit seiner Familie geschehen ist. Leute die nur blind durchrennen und erwarten, dass ihnen alles in Zwischensequenzen vorgekaut wird, werden hingegen nichts verstehen und dementsprechend wenig Freude mit dem Spiel haben. Hier ist viel eher Eigeninitiative und auch ein gewisses Maß an Eigeninterpretation gefragt um die Handlung angemessen nachvollziehen zu können. Diese Art des Storytellings ist freilich nicht jedermanns Geschmack, hat mir persönlich aber sehr gut gefallen. Vor allem weil es in Layers of Fear auch verdammt gut umgesetzt wurde. Denn nicht nur die Notizen und Zettel haben eine Geschichte zu erzählen, sondern vor allem auch das im 19ten Jahrhundert angesiedelte Familienhaus selbst! Es wird ein ebenso kreatives wie grauenerregendes Eigenleben entwickeln und euch gehörig das fürchten lehren, während es gleichzeitig als Fenster in die Psyche eines vom Schicksal gebeutelten Mannes fungiert.
Gemütliches Erschrecken

Der größte Kritikpunkt an Exploration Games, ist der Umstand, dass sie bezüglich Gameplays nicht wirklich viel zu bieten haben. Man läuft halt herum, sucht nach Dokumenten, triggert Monologe und Script-Events, staubt ein paar sammelbare Objekte ab und klaubt vielleicht auch mal einen Schlüsselgegenstand auf, um anderswo eine Tür zu öffnen. In ganz seltenen Fällen darf man auch mal ein simples Zahlencode-Rätsel lösen oder darf einen Apparat wie ein Grammofon oder Telefon bedienen. So läuft es zumindest bei Layers of Fear ab. Im Grunde genommen könnte ich nach diesen paar Sätzen bereits zum Ende kommen, weil ich mit diesen bereits den gesamten Spielinhalt dargelegt habe. Aber der eigentliche Reiz dieses Spiels ist nun einmal nicht das oberflächliche Gameplay, sondern die schauerliche Atmosphäre in Kombination mit clever platzierten Jump Scares, die in diesem Spiel keineswegs aufgesetzt wirken, sondern sich homogen ins Spielgeschehen einfügen.
Anfangs sind es noch harmlose Dinge wie ein offenes Fenster, das plötzlich vor unserer Nase zufällt oder der Fußboden der auf einmal unter uns einbricht. Später wird’s dann zunehmend unangenehmer, so gehen in der Küche auf einmal die Lichter aus, eine unbekannte Entität rüttelt hemmungslos an der verschlossenen Tür und plötzlich sprudeln Äpfel aus dem Stillleben-Gemälde von Antonio de Pereda. Später werden wir dann vom bereits genannten Poltergeist terrorisiert und erleben mit, wie die Zeichnungen und Spielzeugpuppen der Tochter ein beängstigendes Eigenleben entwickeln. Aber es ist nicht möglich diesen Aspekt des Spiels vernünftig zu erklären, es sind einfach Dinge die man selbst erleben sollte. Und mit „selbst erleben“ meine ich, dass man das Spiel selbst spielen sollte. Am besten Nachts im Dunkeln, wenn man alleine im stillen Kämmerchen sitzt und niemand stört.
Trotz der unheimlichen Atmosphäre kann man Layers of Fear jedoch recht „entspannt“ spielen, denn selbst wenn man vom Poltergeist erwischt wird oder sich in einen Abgrund stürzt, geht es kurz darauf weiter mit der Suche nach den benötigten Arbeitsmaterialien – und zwar auf homogene Art und Weise und nicht durch irgendwelche plumpen Checkpoints oder so ähnlich. Es werden einem also keine Stealth-Mechaniken oder dergleichen aufgezwungen, sondern man kann gewisse Situationen so handhaben wie man es für richtig hält. Ich selbst bin z.B. der Ehefrau nie ausgewichen, sondern habe bewusst den Kontakt mit ihr gesucht. Und da ich eines der beiden vernünftigen Endings erhalten habe, war das wohl auch gar keine so schlechte Idee. Dennoch wäre es schön gewesen, wenn man der Spielfigur die Möglichkeit gegeben hätte sich zu ducken und zu kriechen. Das hätte nicht nur der Atmosphäre gut getan, sondern wäre auch hilfreich dabei gewesen untere Schubladen aufzuziehen, was aus dem Stand heraus leider oftmals viel zu umständlich ist und unnötige Präzision verlangt. Generell fühlt sich das öffnen von Türen und Schubladen oder die Bedienung einer Kurbel recht unbequem an, weil man diese als Spieler „eigenhändig“ mit entsprechenden Mausbewegungen öffnen bzw. drehen muss. Aber man gewöhnt sich recht schnell dran und es dient ja auch dazu die Immersion zu steigern, das ist mir durchaus bewusst. Ein weiterer kleiner Kritikpunkt ist die geringe Laufgeschwindigkeit der Spielfigur. Es gibt zwar eine Taste um die Laufgeschwindigkeit zu erhöhen, doch macht sich dies kaum bemerkbar, was natürlich auch an der Beinprothese des Protagonisten liegt.
Leider ist der Schrecken nach 5-6 Stunden wieder vorbei und selbst diese Spielzeit wird nur dann erreicht, wenn man das Spiel so spielt wie es vorgesehen ist, was freilich bedeutet, dass man sich entsprechend Zeit nehmen sollte um die Räume und Gänge ausgiebig zu erkunden, Schubladen nach Notizzetteln zu durchsuchen und auch mal innehalten um die Gemälde realer Künstler wie Rembrandt, Goya oder Bosch zu genießen. Und nicht nur die Gemälde, auch das Mobiliar wird Freunde rustikaler Antik-Möbel Seufzer der Verzückung entlocken.
Darüber hinaus bietet das Spiel auch einen gewissen Wiederspielwert, denn ab der zweiten Spielhälfte wird man mit Abzweigungen sowie optionalen Räumen und Zahlencode-Rätseln konfrontiert. Darüber hinaus gibt es natürlich auch sammelbare Dinge wie Zeichnungen oder Familienfotos, welche freilich an Achievements gekoppelt sind. Das Spiel bietet ferner drei verschiedene Endings, von denen zwei recht befriedigend ausfallen und eines wohl eher als „Du hast versagt, versuch’s noch mal“ zu verstehen ist.
Grafik, Sound und weiteres

Es ist erstaunlich was die polnischen Programmierer aus der Unity-Engine, die ja auch schon in Gone Home Verwendung fand, herauskitzelten. Sowohl die rustikale Ästhetik als auch die sehr gruselige Atmosphäre wird zu einem großen Teil von der stimmigen Grafik getragen. Besonders die Beleuchtung ist hervorragend gelungen. Natürlich wird man stellenweise mit Dunkelheit konfrontiert, der man jedoch teilweise mithilfe von Kerzenleuchtern und Lichtschaltern entgegenwirken kann. An die geschlossenen Fenster peitscht der Regen und die Fußschritte des Künstlers hallen auf dem Boden wieder. Toll fand ich auch, dass man sich die Mühe gemacht hat den Künstler voll zu animieren, statt nur eine schwebende Kamera einzubauen. Und das obwohl man die Spielfigur im Verlauf des Spiels nur ansatzweise in stark beschlagenen Spiegeln sehen kann.
Freilich fügt sich auch der Soundtrack sehr gut ins Spielgeschehen ein. Die Trackliste ist zwar sehr überschaubar, doch verbreiten die Stücke eine einwandfreie Stimmung, welche hauptsächlich in traurig-depressive Richtungen gleitet, aber in Kombination mit der jeweiligen Situation auch sehr unheimlich wirken kann.
Die Sprachausgabe ist zwar nur sehr rar gesät, doch wirken die spärlich eingestreuten Monologe des Künstlers und seiner Ehefrau dafür umso effektiver. Die Sprecher selbst leisten dabei eine einwandfreie Arbeit. Dennoch wäre eine volle Sprachausgabe, wo einem dann auch die Briefe und Dokumente vorgelesen werden, wirklich wünschenswert gewesen. Sogar im Horror-Urgestein „Alone in the Dark (1992)“ war das schon gegeben. Das wäre nicht nur der Atmosphäre zuträglich gewesen, sondern hätte dann auch die Motivation gesteigert nach den Briefen Ausschau zu halten.
Wie im letzten Testsegment bereits klargestellt, verwendet das Spiel reale Gemälde bekannter Künstler. Die Entwickler haben es aber nicht dabei belassen, sondern waren so frei zu einigen Werken eigene alptraumhaft verzerrte Versionen zu schaffen. Nicht umsonst dient die Interpretation von Da Vincis „Dame mit dem Hermelin“ als abscheulicher Nosferatu-Vampir ohne Augäpfel, inzwischen als Markenzeichen von Layers of Fear. Die unterschiedlichen Schichten des Portraits an dem der Ingame-Künstler arbeitet, ist sogar eine komplette Eigenkreation von Bloober Team SA. Da merkt man, dass die Polen richtig viel Herzblut in ihr Spiel gegossen haben!
Das könnte dir auch gefallen





























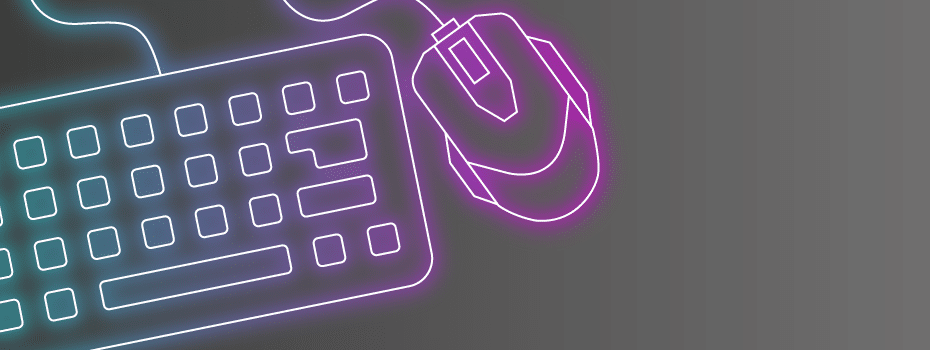


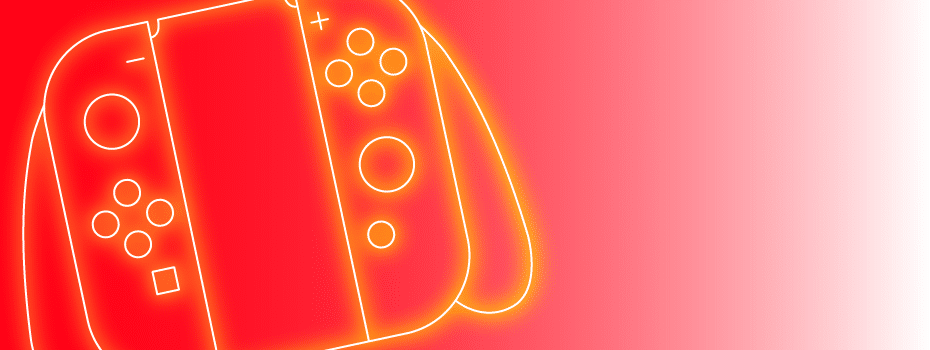











Schreibe einen Kommentar