Atomic Heart REVIEW
Atomic Heart ist gleichzeitig eines der interessantesten wie bizarrsten Spiele, die ich seit langer Zeit gespielt habe. Insofern löst das Debüt des russischen Studios Mundfish immerhin schon einmal ein frühes Versprechen ein, denn wenn sich das in einer alternativen Version der 1950er Jahre spielende Atomic Heart durch eines bereits früh ausgezeichnet hat, dann durch den unverwechselbaren Artstyle, der sich vor allem der sowjetischen Ästhetik und einer gehörigen Portion (Retro-)Sci-Fi bedient.
Komplex und konfus

Bioshock, Prey (2017) und Wolfenstein: The New Order sind die Titel, die ich am ehesten als Vergleich heranziehen würde, um einen ersten Eindruck von Atomic Heart zu geben. Nur sind es hier eben nicht wie im Reboot von Wolfenstein die Nazis, die durch einen technologischen Vorsprung den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, sondern die Sowjets. Grund dafür ist vor allem das in den 1930er Jahren von einem russischer Wissenschaftler entdeckte Polymer, ein elektrisches Speichermedium aus Kunststoff, welches in Folge die Realität dieser alternativen Geschichte verändern und Russland binnen weniger Jahre zu einem hochtechnologischen Land inklusive Robotern machen wird.
Die Handlung selbst spielt 1955, in der die UdSSR nach mehreren Verschiebungen das sogenannte Kollektiv 2.0 endlich an den Start bringen möchte. Hinter der Bezeichnung verbirgt sich ein neurales Netzwerk, welches nicht nur der Bevölkerung der Sowjetunion zur nächsten Stufe der Evolution verhelfen soll, sondern bestenfalls der gesamten Menschheit. Ja, selbst die Kapitalisten sollen diese neuartige Macht erhalten können und von der Überlegenheit des Kommunismus profitieren. Wie das aber nun einmal mit Utopien, vor allem in Videospielen ist, geht das gut gemeinte (aber natürlich nie wirklich ernsthaft gut gemeinte) Vorhaben ziemlich schief, die gesamte Technik und vor allem die Roboter drehen komplett am Rad. Jetzt heißt es aufzuräumen.
Dies macht man als Major Sergei Nechaev, Deckname P-3. Dieser wird irgendwo zwischen allwissend und fish-out-of-water charakterisiert, weiß also einiges über die Welt und ihren Regeln, soll aber dennoch dem Spieler/der Spielerin das Gefühl geben, ständig Neues zu erfahren und zu erleben. Das funktioniert nur bedingt. Ohnehin ist die Geschichte ist ziemlich seltsames Konstrukt, aus dem ich bis zum Ende hin nicht so wirklich schlau geworden bin. Das hat auch mit den unzähligen Fachtermini zu tun, welche mal erklärt werden, mal nicht. Egal ob wissenschaftliche, politische oder soziale Konzepte: Atomic Heart versucht ziemlich komplexe Gedanken aufzugreifen, was mir an sich sympathisch ist. Irgendwie passt das alles aber nicht so richtig zusammen, auch weil die Entwickler zu viel auf einmal wollen. Das ist übrigens ein Problem, welches sich durch das komplette Spiel ziehen wird.
Grandioses Worldbuilding

Wenn Mundfish eines richtig gemacht hat, dann im Vorhaben eine spannende Welt zu kreieren. Vor allem audiovisuell ist diese Vision einer alternativen Realität schlichtweg atemberaubend gut geworden. Aus Radios klingt zeitgenössische Musik, die brutalistischen Bauten spiegeln den aberwitzigen Größenwahn eines Regimes wieder, welches meint, es sei allen anderen Regierungsformen überlegen. Überall hängen Poster und Plakate, die mal Kultur bewerben, mal Propaganda verbreiten, mal die Einigkeit der Nation heraufbeschwören. Ich bin bis zum Ende meines rund 12-stündigen Spieldurchlaufs immer wieder stehen geblieben und habe mir die Plakate angesehen, von denen es massenhaft gibt. Das eigentliche Highlight sind aber die Roboter, die stellenweise derart kreativ sind, dass mir gerade zu Anfang die Augen glänzten. Was das Grafikdepartmend hier geleistet hat, ist in den besten Momenten wirklich herausragend und ziemlich einmalig im Medium Videospiel.
Die von mir gespielte PlayStation 5 Version sieht in den meisten Momenten auch in Hinblick auf die Grafikqualität sehr gut aus. Im Vorfeld überraschte Mundfish mit der Aussage, man würde auf PS5 sowie Xbox Series X keine Auswahl zwischen mehreren Grafikmodi bieten und stelle stattdessen 60 Frames mit angepeilten 4K in Innenräumen sicher, während in den offenen Abschnitten die Auflösung angepasst wird. Und siehe da, man hat den Mund nicht zu voll genommen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass gerade die Open World mitunter ziemlich abfällt im Vergleich zu den geschlossenen Abschnitten.
Zu viel gewollt

Aber wie bereits gesagt: die Entwickler wollten von allem zu viel. Nach meinem Gefühl sollte Atomic Heart ein lineares Erlebnis sein. Als dieses kann man es auch gestalten, folgt man einfach nur der Hauptstory. Allerdings gibt es eine nicht gerade kleine Open World. Die Handlung findet in der Facility 3826 statt, einem wissenschaftlichen Forschungsstandort, der nicht nur aus Laboren, sondern auch Lebensraum für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und deren Familien besteht. Zwischen den mal größeren, meistens aber eher kleineren Orten gibt es viel Natur, Straßen und so weiter. Und auch wenn sich die Entwickler auf dem Papier bemühen, all die Orte, die nicht direkt etwas mit der Story zu tun haben, mit Inhalten und Nebenbeschäftigungen zu füllen, so habe ich nie, aber auch nie den Reiz verspürt, mich wirklich intensiv in der Spielwelt umzusehen. Und das will etwas heißen, denn wenn ich eines in offenen Welten liebe, dann sämtliche relevanten Aufgaben auszublenden und auf Entdeckungstour zu gehen, bis ich jeden noch so kleinen Winkel erforscht habe.
Und ja, es gibt auch hier Nebenaufgaben, die mich tiefer in die Lore einführen und (so nehme ich zumindest an) ein paar der losen Fäden aufziehen. Und auch gibt es Belohnungen, in Form von Ressourcen und Waffenupgrades zu finden. Aber Atomic Heart versucht alles, um mir jeglichen Spaß an der Erkundung zu nehmen. Das liegt leider auch an den eigentlich so spannenden Gegnern. Sobald mich eine Kamera entdeckt, werden sofort alle in der Umgebung verfügbaren Einheiten auf mich gehetzt. Das können mal zwei Gegner sein, mal zehn, mal mehr. Spätestens wenn dann auch noch Reparatur-Bots losgeschickt werden, die besiegte Blechbüchsen wieder zusammenschweißen, ist die Munition ganz schnell aus. Angesichts der dichte an Kameras in der Spielwelt, die man zwar kurzerhand ausschalten kann, die sich aber wieder reaktivieren, und der so immer wieder aufgezwungenen Kämpfe, wurde schnell jegliche Erkundungslust bei mir begraben.
Frust

Ich habe meinen Spieldurchlauf auf dem höchsten der drei Schwierigkeitsgrade begonnen, aber ziemlich früh gemerkt, dass die mechanisierten Gegner schlicht zu viel einstecken und ich so keinen Gefallen an den Kämpfen finde. Also habe ich auf den mittleren Schwierigkeitsgrad umgeschaltet, so wirklich befriedigend waren die Auseinandersetzungen aber noch immer nicht. Als ich einem der wenigen organischen Bossgegner des Spieles nach knapp zehn Minuten und nur mit einer Axt umgehauen habe (Projektilwaffen richten nahezu keinen Schaden gegen diesen Gegner an), bin ich komplett auf Leicht umgestiegen. Erst jetzt hatte ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, wirklich gut in den Kämpfen zurechtzukommen. Und angesichts der absurd großen und lange dauernden Wellen an Gegnern, die gegen Ende auf mich losgelassen wurden, war ich schließlich ganz froh, dass ich es mir einfach gemacht habe.
Auch wenn man Atomic Heart aus der First-Person-Perspektive spielt, so würde ich hier nicht von einem Ego-Shooter sprechen. Daher mein zu Anfang gebrachter Vergleich mit Bioshock und Prey (2017), die sich ja ebenfalls nicht als klassische Shooter, sondern eher als Immersive-Sims verstehen. Entsprechend sollte man die eigenen Erwartungen an das Spielgefühl anpassen, nicht zuletzt auch, da die Vielfalt an Gegnern schnell nachlässt und man immer wieder mit den gleichen Kontrahenten konfrontiert wird, die auf die immer gleich ablaufenden Angriffsmuster setzen. Neben den Waffen bekommt man dank des hochtechnologischen und jederzeit mit P-3 sprechenden Handschuhs namens Charles diverse Fähigkeiten, die man freischalten und wie die Waffen auch mit neuen Upgrades versehen kann. Unter anderem kann man Gegner unter Schock setzen, einfrieren oder einen Schutzschild heraufbeschwören. Damit kommt ein bisschen Abwechslung in die Sache, aber auch nicht viel. Richtig gut, und das auch bis zum Ende, sind aber die meisten Bosskämpfe.
Schnitzeljagd das Videospiel

Ein weiteres Problem ist der eigentliche Gameplay-Loop. Vor allem sucht man nämlich Schlüssel. Mal klassische Schlüssel, mal in Form von Kanistern, mal muss man vier Roboter-Ballerina in eine bestimmte Position bringen, mal Kugeln finden und an Toren einsetzen. Immer wieder steht man vor verschlossenen Türen und muss diese öffnen. Und meine Güte ist Atomic Heart gut darin, diese Schnitzeljagden in die Länge zu ziehen. Selbst P-3 kommentiert das ewige Suchen nach einem Tür- oder Toröffner mit ächzen, spaßiger macht das die Sache aber nicht. Beim Spielen habe ich immer wieder den Eindruck gewonnen, die Entwickler wussten selbst nicht so ganz wie sie das Spiel mit Gameplay füllen. Also haben sie den ältesten Videospiel-Trick angewandt: verschlossene Türen.
Türen öffnen und ballern: das sind die zwei großen Fundamenten, auf denen Atomic Heart mehr mittelmäßig als wirklich gut balanciert. Dazwischen labert man noch mit einem vollkommen aufgegeilten Automaten und bastelt sich an diesem Waffen und Upgrades zusammen. Auch muss man immer wieder kleine, aber immerhin kreative Minispiele lösen, um – man mag es ahnen – Türen zu öffnen.
Pro & Kontra
- grandioses Worldbuilding
- fantastisches Artdesign
- coole Bossgegner
- durchaus interessante Rätsel
- konfuse Narration
- Kämpfe werden mit zunehmender Spielzeit eintönig
- Open World wurde nicht mit interessanten Inhalten gefüllt
- Missionen laufen meist nach dem selben Muster ab (öffne Tür x, öffne Tür y...)
Das könnte dir auch gefallen



























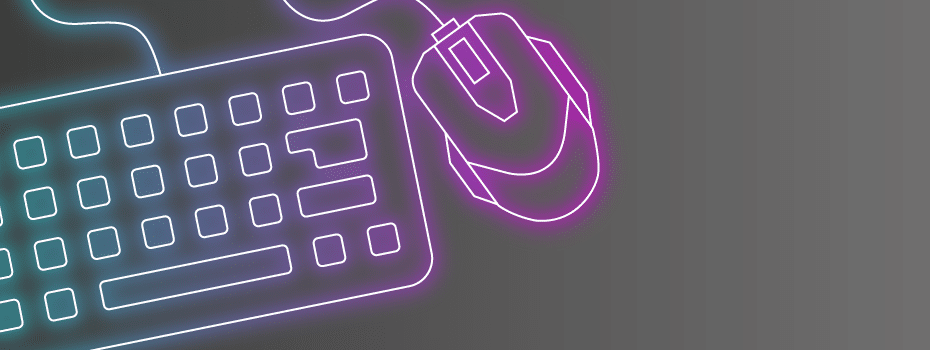


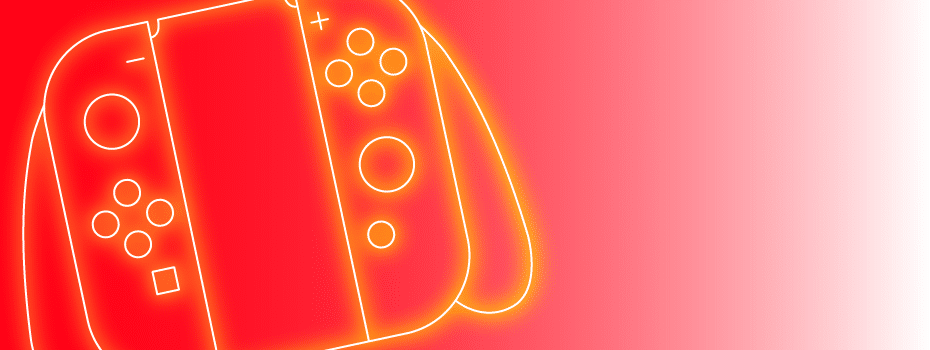











Schreibe einen Kommentar