Pay-to-win – Das nervige Phänomen der Spielewelt
Bei Videospielen geht es seit jeher vor allem um eine Sache – Spaß. Bereits seit dem legendären Ataris Pong, ging es um den lustigen Zeitvertreib für zwischendurch, auch wenn dieser damals noch sehr simpel war. Die Spiele auf dem heutigen Markt sind deutlich komplexer als ihre Vorgänger. Neben dem reinen Unterhaltungsaspekt kam mit dem Aufstieg von eSport auch eine professionelle und wettbewerbsorientierte Komponente hinzu. Somit sind beim Zocken Skills gefragt, ohne die es zugegebenermaßen häufig nicht besonders lustig ist. Die Motivation und der Anreiz kommen aber auch eben daher, sich über Übung in die unterschiedlichsten Spiele einzuarbeiten und am persönlichen Können zu feilen.
Geld statt Talent

So mussten sich die Zocker für erfolgreiches Gelingen in den Games stets weiterentwickeln und verbessern, um sich mit den Besten messen zu können. Doch seit ungefähr einem Jahrzehnt gibt es eine neue Möglichkeit: Pay-to-win nennt sich das Prinzip, also das Bezahlen, um zu gewinnen. Ein Begriff, den man in der Gaming-Szene in den letzten Jahren vermehrt hören und lesen konnte. Es müssen zum besseren Verständnis weitere Unterscheidungen getroffen werden, denn das Nutzen von Geld ist grundsätzlich nichts Neues. Allerdings hatte es bis dahin nie einen solchen Einfluss auf das Fortschreiten im Spiel.
So gingen zum Beispiel seltenen Skins für Waffen oder andere Spielgegenstände bei Counterstrike seit Jahren für teils horrende Summen über die digitale Ladentheke, ein besserer Spieler wurde man davon allerdings nicht. Geld einzusetzen um zu gewinnen? Das gab es vorher nur bei klassischen Glücksspielen, wie in Echtgeld Casinos, bei denen mit tatsächlichen finanziellen Ressourcen gespielt werden kann. Wobei sich aber logischerweise die Höhe des Einsatzes nicht auf die Gewinnchancen an sich auswirkt, sondern auf die Höhe des zu erwartenden Gewinns.
Mehr Talent zu erkaufen ist unmöglich und gibt es dementsprechend auch in diesen Bereichen nicht. Jetzt lässt sich allerdings in vielen Games beinahe das erreichen – mangelndes Können kann durch finanziellen Einsatz wettgemacht werden.
Geht es beispielsweise um Spiele wie FIFA, speziell der Ultimate Team Modus, ist der Erfolg von der Stärke der Mannschaft abhängig. Hier kommen sogenannte Mikrotransaktionen ins Spiel. Diese finden nämlich bei der Sportsimulation ihren Anfang. Seit 2009 wurde FIFA Ultimate Team in das Franchise aufgenommen, davor war es nur bei einem Ableger von EA zu finden, der sich rein mit dem Wettbewerb der Champions League beschäftigte. Das Prinzip des Modus ist simpel. Anstatt wie gewöhnlich mit feststehendem Team zu spielen, hatten die Gamer nun die Möglichkeit, ihre Mannschaft selbst zu kreieren. Dazu wurden Karten der Sportler erspielt und getauscht, um sich nach und nach ein besseres Team aufzubauen.
Wer dafür nicht seine Zeit investieren wollte, hatte die Möglichkeit mit echtem Geld in-game Währung zu kaufen. Damit konnten – und können bis heute – anschließend Kartenpäckchen erworben werden. Somit können sich Spieler einen enormen Vorteil erkaufen, ohne entsprechende Leistung im Spiel. Auch wenn dieser Ansatz von FIFA relativ hohe Wellen schlug, gibt es für die Spieleentwickler ein gutes Argument ihn zu behalten – Geld. Der Profit der Studios allein durch Mikrotransaktionen geht in die Milliardenhöhe. Auch bei Star Wars Battlefront II, was ebenfalls von EA herausgegeben wird, zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Bei diesem Titel konnten sich ebenfalls durch reales Geld entscheidende Vorteile gegenüber anderen Spielern verschafft werden.
Mobile Games stark vertreten

In der Sparte der Mobile-Games für Smartphones und Tablets ist dieses Schema ebenfalls deutlich zu erkennen. Grundsätzlich wächst diese Abteilung des Gamings rasant und findet sich in vielen Altersgruppen auf dem ersten Platz der beliebtesten Spieleplattformen wieder. Ein Großteil der verfügbaren Spiele ist außerdem kostenlos, zumindest in der Theorie. Denn in den meisten Fällen findet sich auch hier Währung innerhalb des Spiels, häufig in Form von Gold, Tickets oder Edelsteinen. Diese kann man in geringer Stückzahl im Spiel freischalten, wodurch der Nutzen schnell ersichtlich wird. So können zum Beispiel lange Wartezeiten oder Zwangspausen überbrückt werden. Wer sich daran gewöhnt hat, neigt schnell dazu mehr davon zu brauchen beziehungsweise zu wollen. Für echtes Geld ist dann rasch eine große Menge der Spielwährung gekauft. Nun wird im Game damit bezahlt, wodurch der Spieler gerne vergisst, dass es sich unterm Strich doch um echtes Geld handelt.
Bekannte Mobile-Games wie Candy Crush oder Die Simpsons: Springfield sind nur zwei der schier unendlichen Titel, die genau diesem Prinzip folgen. Doch wohin geht die Reise von pay-to-win? Schließlich bedeutet es für viele Gamer, die um des Spaßes Willen spielen, einen echten Tiefschlag. Viele Entwickler wollen dahinkommen, dass käufliche Spielgegenstände nur noch ästhetischen Wert haben. So können Skins für Waffen erworben werden oder das Aussehen der Charaktere verändert werden, ohne dass Einfluss auf das Gameplay genommen wird. Ein Vorteil gegenüber anderen Spielern bliebe somit aus. Auch gesetzliche Neuerungen könnten zukünftig pay-to-win Inhalte einschränken. In den USA ist es momentan ein heiß diskutiertes Thema, doch eine endgültige Entscheidung steht noch aus.
Es wäre finanziell gesehen ein echter Verlust für die Studios, sollte es in der Zukunft unterbunden werden. Für die Gamer wird es aber sicherlich ein wichtiger Schritt zu mehr Spielspaß. Dann geht es wieder darum sich durch Mühe und Einsatz im Spiel zu verbessern, anstatt mit der Kreditkarte.
Das könnte dir auch gefallen






























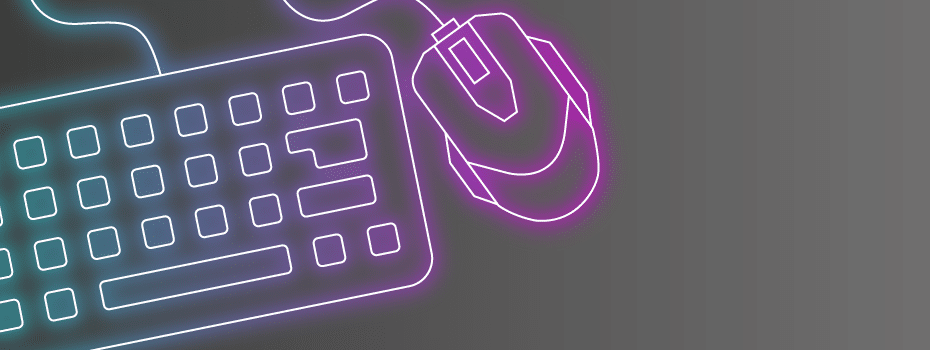


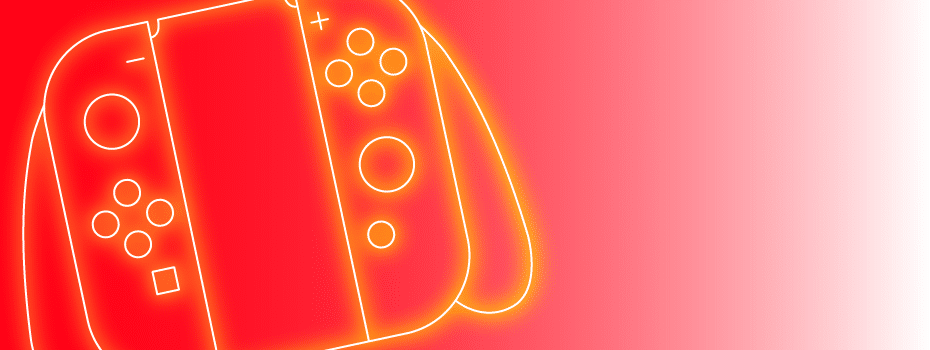











Schreibe einen Kommentar